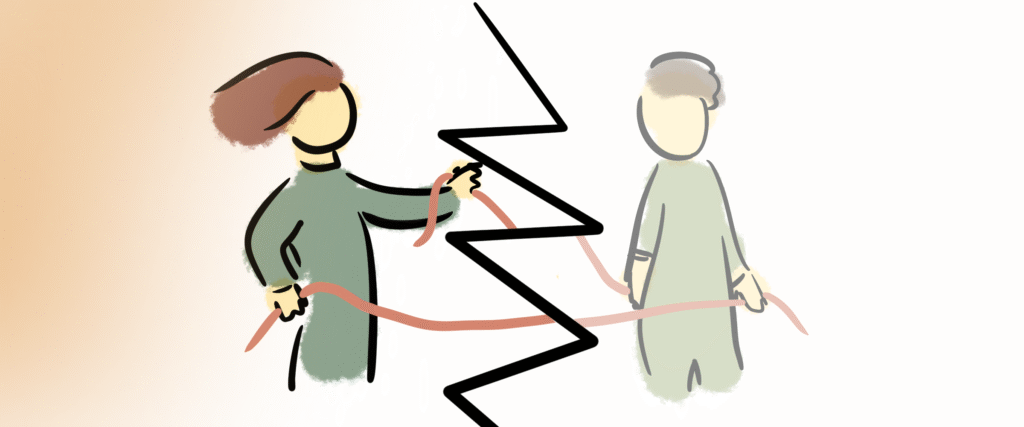
Es gibt kaum etwas, das in einem professionellen Umfeld zugleich so selbstverständlich und so unsagbar schwer erscheint wie Trauer. In Organisationen, die auf Effizienz, Produktivität und klare Ergebnisse getrimmt sind, wirkt Trauer oft wie ein Störfaktor, eine emotionale Bremse. Doch gerade hierin liegt eine paradoxe Wahrheit: Trauer ist ein unvermeidbarer Teil dessen, was uns als Menschen auch am Arbeitsplatz verbindet. Sie ist kein Versehen oder Luxus, sondern ein tief menschliches Signal – und deshalb absolut legitim.
Unterschiedliche Verlusterfahrungen
Nicht jeder Verlust ist gleich. Der schockierende, plötzliche Tod einer Kollegin trifft das Team wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Diese Art des Verlusts reißt das Fundament emotionaler Stabilität unvermittelt weg, macht das Unfassbare unmittelbar spürbar. Im Gegensatz dazu steht der Tod nach langer Krankheit: Hier gibt es oft eine Phase des Vorbereitens, Abschiednehmens, des „Mitgehens“ durch die Krankheit. Der Schmerz der Trauer ist zwar nicht weniger real, doch es gibt Zeit, die eigene emotionale Landkarte vorsichtig neu zu zeichnen.
Nicht nur Tod ist Verlust
Trauer ist aber viel mehr als die Reaktion auf den Tod. Verlusterfahrungen im Arbeitskontext gehen weit darüber hinaus und zeigen sich in vielfältigen Formen: Das Scheitern eines Projekts, das einem lange am Herzen lag, die Kündigung einer beliebten Kollegin oder eine unfreiwillige Umstrukturierung, die das vertraute Arbeitsumfeld nachhaltig verändert. Jede dieser Erfahrungen kann eine Trauerreaktion hervorrufen. Trauer ist immer auch Trauern um etwas, das nicht mehr ist oder nicht mehr sein wird. Es ist die schmerzliche Wahrnehmung einer gekappten Verbindung und die Sehnsucht nach dem, was hätte sein können.
Was bedeutet eigentlich Trauer?
Trauern heißt, etwas zu betrauern. Und dieses „Etwas“ ist immer eine Verbindung — eine Beziehung, ein Erwartungshorizont, eine gemeinsame Zeit oder ein gemeinsames Ziel, das nicht mehr erreichbar ist. Im Arbeitsleben ist das oft eine unsichtbare, aber keineswegs unbedeutende Verbindung: Zwischen Kolleg:innen, zwischen Individuum und Team, zwischen Engagement und Ergebnis.
Diese Verbindungen sind es, die uns überhaupt erst im Arbeitsleben halten und identifizieren lassen: Das kollegiale Miteinander, die gemeinsame Identifikation mit der Arbeit, die Hoffnung, zusammen etwas zu schaffen. Doch genau diese positiven Verbindungen bergen auch die Gefahr des Schmerzes. Denn wo Verbundenheit ist, kann Verlust nicht fern sein. Wenn Menschen zusammenkommen, um gemeinsame Ziele zu verfolgen, schaffen sie auf unsichtbaren Ebenen Beziehungen, die im Fall von Verlust reißen und tief schmerzen.
Warum Trauer am Arbeitsplatz oft negiert wird – und warum das gefährlich ist
Organisationen leben davon, dass sich Menschen einbringen, kooperieren und an gemeinsamer Leistung arbeiten. Gleichzeitig wird aber heute vielerorts die emotionale Seite dieser Verbindungen ausgespart oder unterschätzt. Trauer und Verlusterfahrungen gelten oft als privat, als Störung des Arbeitsflusses, als etwas, das man „besser draußen lässt“. Diese Haltung ignoriert, dass es in jedem Verlust eine Geschichte von Verletzlichkeit und Verbundenheit gibt. Werden diese Teile menschlicher Erfahrung im Arbeitskontext negiert, entsteht eine gefährliche Kluft.
Denn: Wer das Trauern am Arbeitsplatz tabuiert, übersieht, dass die Wunden dadurch nicht verschwinden — sie werden nur verschlossen, internalisiert und damit auch auf Dauer wirksam. Die Folge sind oft unerklärliche Spannungen, sinkende Motivation, mangelnde Vertrauensbildung – kurz: ein organisationaler Schaden, dessen Ursachen unbenannt bleiben. Wer Trauer Raum gibt und als Teil der Arbeitsrealität anerkennt, schafft nicht nur menschlicheren Umgang, sondern auch ein stärkeres Fundament für Resilienz und langfristige Verbundenheit.
Die Einladung, Trauer als Teil des Arbeitslebens zu sehen
Es braucht einen kulturellen Wandel, der nicht alles seziert in Businesscase und Effizienz, sondern anerkennt: Menschen bei der Arbeit sind nicht nur Köpfe, Hände und „Ressourcen“, sondern Wesen, die mit Verbindungen leben – und wenn diese Verbindungen abbrechen, dann schmerzt das. Es ist kein Zeichen von Schwäche, sondern Ausdruck gelebter Verbundenheit, wenn Trauer am Arbeitsplatz sichtbar wird und anerkannt wird.
Insofern ist die Frage „Darf man am Arbeitsplatz trauern?“ viel eher eine Einladung zu fragen: Wie können wir als Organisation Räume schaffen, in denen Trauer ihren Platz hat, ohne dass die Arbeit darunter zusammenbricht? Denn nur wenn wir den Verlust anerkennen, können wir auch den Wert der Verbindung bewahren – und uns daran erinnern, warum wir überhaupt zusammenarbeiten wollen.
Wenn dieser Blick gelingt, wird Trauer nicht zur Störung, sondern zu einem Signal, das zeigt, dass wir Menschen sind – mit allen Kräften, Verletzlichkeiten und Sehnsüchten, die das Leben und die Arbeit ausmachen.
—
Falls die Beschäftigung mit dem Thema gerade schwerfällt, oder jemand im Team Unterstützung braucht: Professionelle Gesprächspartner, etwa bei der Telefonseelsorge, sind immer eine gute Anlaufstelle. Und wer Beratung für das Team sucht, kann sich gerne an mich wenden.
