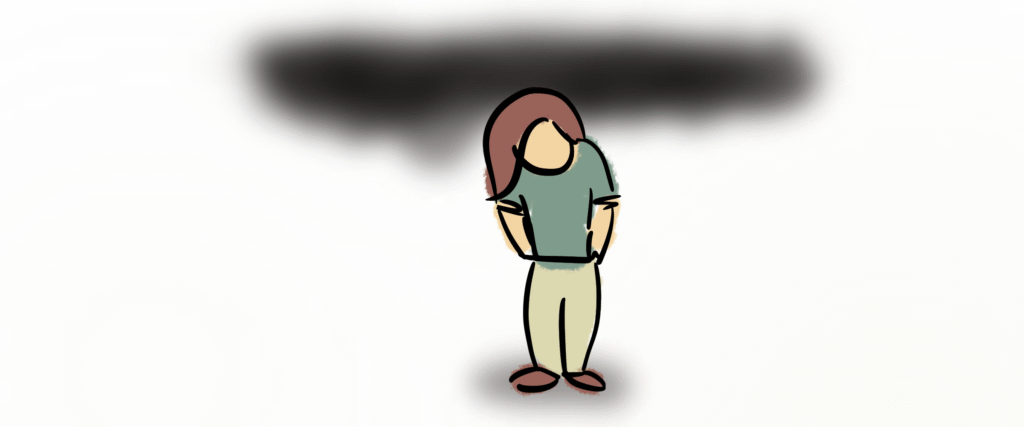
Die Logik hinter den Schuldgefühlen
Ein Kollege stirbt – und mit der Trauer kommt oft ein quälendes Gefühl: Schuld.
Hätte ich die Anzeichen sehen müssen? Hätte ich mehr fragen sollen?
Diese Schuldgefühle nach einem Todesfall am Arbeitsplatz sind häufiger als gedacht — und psychologisch erklärbar. Schuld gibt uns zurück, was der Tod uns genommen hat: das Gefühl von Kontrolle.
Wenn wir uns schuldig fühlen, suggerieren wir uns: Die Situation wäre vermeidbar gewesen. Das ist der unbewusste Deal: lieber ein schlechtes Gewissen als das Gefühl, völlig machtlos zu sein.
Lieber schuldig als ohnmächtig
Ohnmacht ist schwer auszuhalten. Sie konfrontiert uns mit der Tatsache, dass wir nicht alles beeinflussen können, dass das Leben unberechenbar ist. Schuld hingegen bietet eine Erklärung, ein Narrativ, eine Handlungsoption — zumindest theoretisch. Sie schützt uns vor der Erkenntnis: Es gibt Dinge, die wir nicht verhindern können.
Schuld erfüllt eine Funktion. In einer Situation, die absolut unkontrollierbar ist — ein Mensch stirbt, und wir können nichts rückgängig machen — bietet Schuld eine merkwürdige Erleichterung: Sie suggeriert, dass die Situation doch hätte verhindert werden können. Wenn ich schuld bin, dann hätte ich es in der Hand gehabt. Dann war ich nicht einfach ausgeliefert. Das ist paradox, aber psychologisch nachvollziehbar: Lieber selbst verantwortlich als hilflos.
Zwei Gesichter der Ohnmacht
Der Sturz in die Arbeit
Julia arbeitet seit dem Tod des Kollegen wie besessen. Sie übernimmt Aufgaben, die nicht ihre sind, bleibt bis spät abends, antwortet auf E-Mails um Mitternacht. Auf Nachfrage sagt sie knapp: „Irgendjemand muss es ja machen.” Im Team entsteht Unbehagen: Manche finden ihr Verhalten übertrieben, andere fühlen sich unter Druck gesetzt.
Was hier passiert: Julia kämpft gegen die Ohnmacht an, indem sie Kontrolle durch Aktivität herstellt. Vielleicht fühlt sie sich schuldig, weil sie im letzten Gespräch mit dem Kollegen ungeduldig war. Vielleicht hadert sie damit, nicht genug nachgefragt zu haben. Ihre Überaktivität ist ein Versuch, nachträglich „etwas zu tun” — auch wenn es rational keinen Zusammenhang gibt.
Der Rückzug ins Schweigen
Markus hat sich seit dem Tod kaum noch gemeldet. Im Team-Meeting sitzt er dabei, sagt wenig, wirkt abwesend. Auf direkte Ansprache reagiert er gereizt: „Was soll ich denn sagen? Ist doch eh alles egal.” Einige Kolleg:innen interpretieren das als Desinteresse, andere sind verunsichert.
Was hier passiert: Markus ist möglicherweise von der Ohnmacht überwältigt — und zieht sich zurück, weil er keine Worte findet, kein Handlungsschema, keine Rolle, in der er sich sicher fühlt. Vielleicht fühlt er sich auch schuldig, weil er nichts fühlt — oder weil er insgeheim erleichtert ist, dass es nicht ihn getroffen hat. Diese Meta-Schuld (Schuld über das, was man fühlt oder nicht fühlt) ist besonders schwer auszuhalten.
Die mentale Schleife
Entscheidend ist, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Nach einem Todesfall kreisen viele Menschen in einer Art Gedankenschleife: Schuld, Ohnmacht, das, was fehlt, Fragen ohne Antworten. Diese Fokussierung ist ein Versuch des Gehirns, das Unbegreifliche durch Wiederholung zu verarbeiten – neurobiologisch sinnvoll, aber manchmal auch blockierend.
Wenn die Aufmerksamkeit ausschließlich auf dem Problem ruht, verfestigt sich das Muster: Jedes Mal, wenn wir diese Gedanken denken, verstärken wir die neuronalen Bahnen. Die Schuld wird zur mentalen Schleife, in der wir gefangen sind, weil sie paradoxerweise Struktur gibt.
Gleichzeitig können wir versuchen, unsere Aufmerksamkeit bewusst zu lenken und ihr anderes, begleitendes „Futter” zu geben. Das bedeutet nicht, die Schuld zu verdrängen oder wegzureden. Es bedeutet, auch Raum für andere Erfahrungen zu schaffen: Momente von Verbindung, Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse, Gespräche mit Menschen, die uns halten.
Fragen zur Selbstreflexion
Was hätte ich wirklich wissen oder tun können?
Unterscheide zwischen realer Verantwortung und dem Bedürfnis nach Kontrolle. Oft sind wir uns selbst gegenüber viel strenger, als wir es mit anderen wären.
Eine hilfreiche Übung: Stell dir vor, eine Freundin erzählt dir diese Geschichte. Was würdest du zu ihr sagen? Wahrscheinlich würdest du sanfter mit ihr umgehen, als du es mit dir selbst tust.
Wofür steht meine Schuld?
Ist sie ein Versuch, Ohnmacht erträglicher zu machen? Ein Ventil für andere Gefühle wie Wut, Traurigkeit oder Angst? Eine alte Gewohnheit aus der Kindheit, als du gelernt hast, dass du für die Gefühle anderer verantwortlich bist?
Wenn wir verstehen, welche Funktion die Schuld erfüllt, können wir anders mit ihr umgehen. Sie wird vom Feind zum Wegweiser.
Warum Schuld Respekt verdient
Schuld ist kein Fehler im System. Sie ist ein Versuch, das Unbegreifliche begreifbar zu machen. Und manchmal ist das Wichtigste, was wir tun können: sie da sein lassen, ohne sie zu bewerten. Zu wissen, dass auch wir selbst nur Menschen sind, die manchmal nicht wissen, was zu tun ist.
Der Tod zeigt uns: Wir sind soziale Wesen. Als Menschen gehen wir Verbindungen ein. Wenn diese plötzlich gekappt werden, bleibt erstmal nur der Schmerz über diesen Verlust. Dieser Schmerz – und auch die Schuld, die ihn manchmal begleitet – braucht Raum und Würdigung.
Tod und Arbeit — eine kleine Reihe
Bisherige Artikel dieser Reihe:
